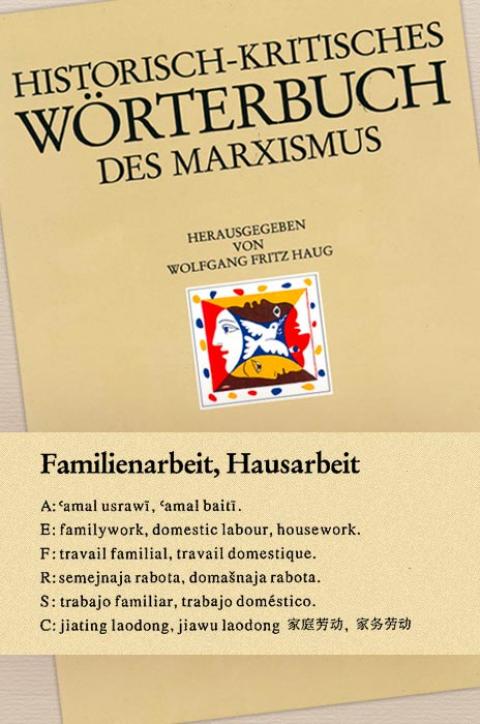
Der Beginn feministischer Auseinandersetzung mit Marx begann mit Maria Rosa Dalla Costas Intervention (1973) und setzte sich fort als Hausarbeitsdebatte, eine Problematik, die philologisch genaue Lektüre von Marx und Engels erfordert. Doch die in dieser Debatte herausgearbeiteten Kritikpunkte knüpfen sprachlich ungenau an Marx und Engels an, sowohl was ›Arbeit‹ als auch was ›H‹ angeht und dringen daher nicht zu einer triftigen Kritik der Reproduktionsverhältnisse und ihrer begrifflichen Fassung vor.
Marx und Engels schreiben nicht nur über Arbeit als Lohnarbeit, wie in der feministischen Debatte unterstellt, sondern benutzen eine ganze Reihe von Begriffen, um die im Haus für die Konsumtion oder für den Markt, in Eigenregie oder für das Kapital verrichteten Tätigkeiten zu fassen. Als H etwa bezeichnen sie zumeist die im Haus verrichtete Erwerbsarbeit und behandeln das im 20. Jh. unter H Gefasste unter F. Die Problematik konzentriert sich auf die Frage, wie die Arbeitsteilung der Geschlechter in Reproduktions- und Produktionsarbeit in die KrpÖ Eingang gefunden hat, wie also die als F bzw. als H gefassten Tätigkeiten im Gesamt der gesellschaftlichen Arbeit und der Reproduktion der Gesellschaft verortet werden, deren Behandlung/Nichtbehandlung die feministische Diskussion um den Arbeitsbegriff von den 1970er Jahren bis zum Ende des Jahrhunderts beschäftigte.

 von
von  von
von  von
von  von
von