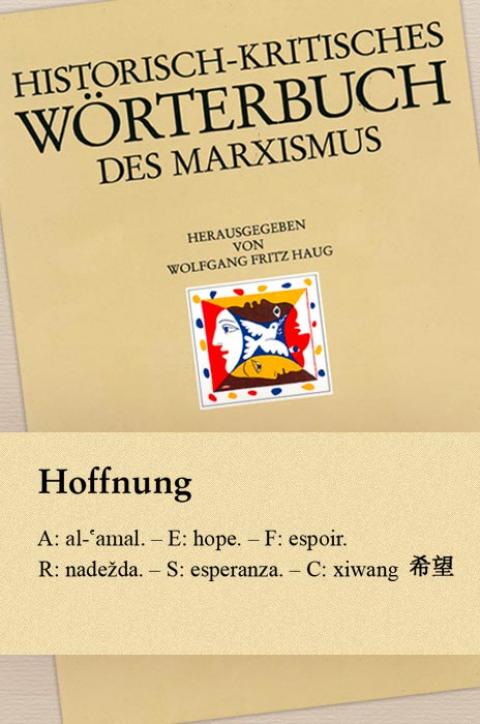
Die romanischen Bezeichnungen gehen auf das lateinische spes/sperare zurück, an dem man noch die Doppelbedeutung einer positiven, freudigen Erwartung und eines neutralen Bezugs auf Zukünftiges ablesen kann. Noch Vergil verwendet sperare fürs Erwarten eines Schmerzes (sperare dolorem; Äneis IV, 419). Die griechischen Äquivalente ἔλπις ἐλιπίζειν bedeuten ursprünglich v.a. »allgemein und formal den Zukunftsbezug« (Link 1974, 1157), dem die neutralen Begriffe des Erwartens, Vermutens entsprechen. Spuren davon fi nden sich noch im modernen Sprachgebrauch, z.B. im spanischen esperar (warten). Das Grimmsche Wörterbuch berichtet noch 1877 von einer allgemeinen Bedeutung von »etwas erwarten, warten« – z.B. in der Jägersprache (»nach dem Fuchs hoffen«) (IV, 1669).
Für ein Verständnis der philosophischen Kontroversen um die H ist die Diskrepanz zwischen antiker und moderner Verwendung von Bedeutung. In der Sprachgeschichte schwingen zwei andere inzwischen verlorengegangene Bedeutungsstränge mit, nämlich zum einen der im Erwarten mitenthaltene Aspekt des Wartens, der vom Standpunkt einer aktiv eingreifenden Praxis als passive Haltung erscheint, zum anderen der v.a. in den antiken Verwendungen vorrangige Sinn eines Für-wahrscheinlich-Haltens. Die H konnte daher sowohl in die Nähe der Untätigkeit als auch der δόξα (der bloßen Meinung) und der illusio gerückt werden.

 von
von  von
von  von
von  von
von